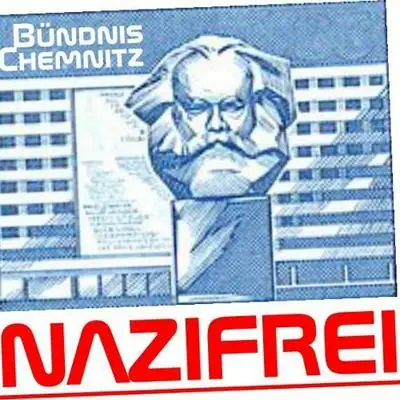Während die Nacht des 09.11.1938 auf den 10.11.1938 einen offen gewaltsamen Höhepunkt des Antisemitismus in Chemnitz und anderswo darstellte, hatten unter anderem jüdische Schüler:innen im Vorfeld schon lange Schikane und Ausgrenzung erfahren. Nachdem Kinder liberaler Jüd*innen 1879 durch den sächsischen Kultusminister die Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht der öffentlichen Schule untersagt wurde, musste die jüdische Gemeinde in Chemnitz schon früh beginnen selbst für die ausreichende Bildung ihrer Kinder zu sorgen. Jüd:innen besuchten fortan den durch die Gemeinde organisierten Religionsunterricht, erst in Räumen der neuen Synagoge, später in der heutigen Gebrüder Grimm Schule. Dieses Angebot war bis zum Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft Teil einer selbstbewusst auftretenden und stetig wachsenden jüdischen Gemeinschaft in Chemnitz, welche maßgeblich am Leben der Stadt beteiligt war.
Im Zuge der sich weiter verstärkenden Ausgrenzung erfolgte mit dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft auch die offizielle Übertragung des nun Pflichtfach gewordenen Religionsunterrichtes an die liberale Religionsschule und die im Laufe des ersten Weltkrieges etablierte orthodoxe Talmod-Tora-Schule. Weiterhin sah sich die Gemeinde in der Pflicht, sich in ihrer Erziehung gegen die zunehmenden Anfeindungen zu stellen. Über diverse Aktivitäten und Programme sollten die Kinder der Gemeinde eine Stärkung ihrer Identität als Jüd:innen erfahren und außerhalb des durch Antisemitismus geprägten Alltags positive mit dem Judentum verknüpfte Erfahrungen machen. Jedoch wurde es auch immer schwerer formelle Abschlüsse zu erlangen. Immer mehr Jüd:innen mussten ohne einen Volksschulabschluss die Schule verlassen und fanden weder Möglichkeiten zur Weiterbildung, noch Lehrstellen. Die Chemnitzer Gemeinde bot so ab 1935 umfangreiche, ehrenamtlich geführte Fortbildungskurse an, welche einerseits das weitere Leben in Deutschland erleichtern sollten, andererseits aber unter dem Druck der antisemitischen Verhältnisse auch eine etwaige erfolgreiche Emigration ermöglichen sollten. In vorauseilendem Gehorsam entschied die Chemnitzer Schulbehörde 1936 keine jüdischen Schüler:innen mehr an höheren Schulen aufzunehmen, 1938 war das nationalsozialistische Ziel, Jüd:innen komplett aus höheren Schulen auszuschließen, erreicht. In Chemnitz wurde dies schon erfüllt bevor eine derartige Reichsregelung verabschiedet wurde. Ab Ostern 1938 führten die Chemnitzer Schulbehörden, in ähnlicher Motivation, den vollständigen und ersatzlosen Ausschluss jüdischer Kinder aus allen Chemnitzer Schulen ein. So blieben die jüdischen Schüler:innen trotz weiterhin bestehender Schulpflicht ohne Möglichkeit Schulunterricht zu besuchen.
Jüdische Schulkinder sollten ab Juni 1938 in Sammelklassen im Gebäude der Brühlschule für Mädchen in der Mühlenstraße 94 unterrichtet werden (siehe Foto). Die Wahl fiel auf diese Schule, da sich der Gebäudeteil, in dem jüdische Schüler:innen und Lehrkräfte untergebracht wurden, vollständig vom Rest der Schule trennen ließ und einen separaten Eingang besaß, durch den der Kontakt jüdischer Schüler:innen mit dem Rest verhindert wurde. Auf den Protest des Schulleiters antwortete der Bezirksoberschulrat: „Gewiss möchte ich die jüdischen Kinder am liebsten in der schlechtesten Baracke unterbringen; es kann aber zur Zeit keine frei gemacht werden“. Aufgrund eines Mangel an jüdischen Lehrer:innen wurden für die 154 Kinder anstatt der benötigten vier nur drei Lehrer:innen eingestellt: Leo Elend, Herta Mühlfelder und Julius Zellner.
Nach der Abschiebung von Jüd:innen mit polnischer Staatsangehörigkeit vom 27. auf den 28. Oktober 1938 vermeldete der Bezirksoberschulrat freudig, dass die Anzahl an Kindern in der Sammelklasse nun nur noch 56 betrage und entließ Hertha Mühlfelder. In der Nacht des 9.11. wurden die beiden verbliebenen Lehrer verhaftet und nach Buchenwald verschleppt. Leo Elend konnte am 28.11. nach Chemnitz zurückkehren und beging am 8.3.1939 Suizid. Julius Zellner konnte 1939 nach Aachen umziehen und wurde von dort nach Auschwitz deportiert.
Am 9.12.1938 schloss die Schulbehörde Chemnitz die jüdische Schule in der Mühlenstraße 94. Im Mai 1939 bat die jüdische Gemeinde das Schulamt um Erlaubnis für die 76 verbleibenden Schüler:innen eine private Schule in einem Judenhaus in der Zöllnerstraße 6 einrichten zu dürfen. Nach Umbauten im Juni begann der Unterricht hier zum 21. August 1939. Innerhalb des ersten Monats halbierte sich die Anzahl der Kinder die den Unterricht besuchten, teilweise konnten die Kinder mit ihren Familien Deutschland verlassen, teilweise wechselten sie zu anderen jüdischen Bildungseinrichtungen außerhalb Chemnitz und Hachschara-Zentren in Vorbereitung auf eine Auswanderung nach Palästina. Im April 1940 verblieben noch 26 Kinder in 7 Jahrgängen. In diesem Zeitraum wurden die Unterrichtsräume in eine Barracke auf dem jüdischen Friedhof verlegt. Im Juni 1940 erfolgte eine geheim gehaltene Anweisung des Reichserziehungsministeriums an die Länder, nach der bis zum 30. Juni 1942 alle jüdischen Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen geschlossen werden sollten und keinerlei Bildung mehr stattzufinden habe. Die Chemnitzer Schule auf dem Friedhofsgelände wurde spätestens zu diesem Zeitpunkt geschlossen.
Das Gebäude auf der Mühlenstraße 94 existiert heute noch immer gegenüber der heutigen Rosa Luxemburg Schule. In dem Gebäude findet heute „Radio-T“ sowie das „Musikkombinat“ Chemnitz Platz.